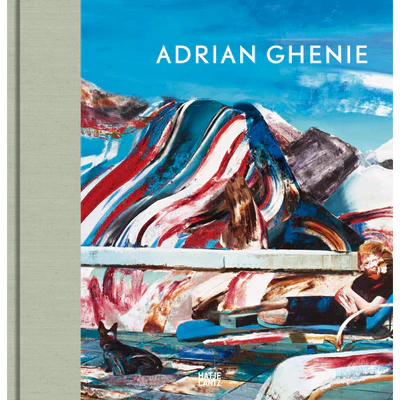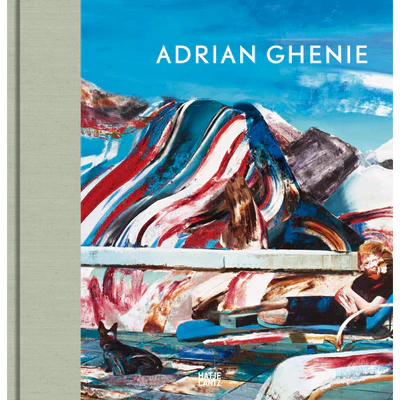| Sprache: |
ADRIAN GHENIE IM GESPRÄCH MIT KLAUS SPEIDEL

In Schattenbilder erweckt Adrian Ghenie Egon Schieles verlorene Werke, die nur noch durch Schwarz-Weiß-Fotografien bekannt sind, zu neuem Leben. Diese unauffindbaren oder zerstörten Gemälde, die Themen wie Tod, Sexualität und Melancholie behandeln, werden von Ghenie zu neuem Leben erweckt, die die Grenzen zwischen Realität und Abstraktion auflösen. Die Ausstellung, die bis zum 2. März 2025 in der ALBERTINA in Wien zu sehen ist, basiert auf einem Konzept von Ciprian Adrian Barsan (C.A.B.) und lädt die Besucher zu einer metaphysischen Reise durch Zerfall und Neuschöpfung ein.
Adrian Ghenie, einer der herausragendsten Maler seiner Generation, hinterfragt historische und künstlerische Narrative und kombiniert persönliche Erinnerungen mit Kunstgeschichte. Im Gespräch mit Klaus Speidel, Kunsttheoretiker und Kurator, spricht Ghenie über seinen Weg in die Malerei, Neuorientierungen und seinen Bezug zum Werk von Egon Schiele.
Klaus Speidel: Ich habe einmal gelesen, dass du willst, dass die Werke das Atelier schnell wieder verlassen, wenn sie fertig sind. Wie geht es dir mit ihnen jetzt?
Adrian Ghenie: Das Problem ist, dass mir, je länger ich sie ansehe, immer mehr Fehler auffallen, Dinge, die ich ändern möchte. Ich denke: »Das ist nicht schön, das würde ich gerne ändern.« Da ist dieser innere Konflikt ... vor allem, wenn man so arbeitet wie ich, mit einer rohen Einstellung. Da gibt es kein Glätten. Man macht also etwas, und es hat diese Rohheit und dann fragt man sich: »Soll ich es glätten?« Man will, dass es so ist, wie es ist. Aber es gibt einen anderen Instinkt, der dir sagt, dass du es glätten solltest; eine Art Handwerksinstinkt. Jeder Maler ist ein Handwerker. Und du sagst dir: »Ja, es ist zu schnell gegangen!« oder »Es ist zu grob!« oder »Ich muss es glätten. Dann werde ich meine Fähigkeiten zeigen.« Doch wenn man das tut, ruiniert man die Lebendigkeit.
KS: Das scheint ein Beispiel für die Spannung zwischen zwei typischen Instinkten zu sein, einem möglicherweise moderneren und einem akademischeren. Du bist jemand, der weiß, wie man etwas glättet, weil du gelernt hast, in einer traditionellen Manier zu malen. Ich nehme an, dass Künstler*innen, die nicht über das akademische Wissen verfügen, dieses Problem nicht haben. Du hast die nötigen Fähigkeiten. Deshalb hast du das Problem.
AG: Ja, jetzt versuche ich, beim Malen so schnell wie möglich zu sein. Ich bereite viel vor. Ich zeichne, ich versuche irgendwie, die Dinge in meinem Kopf zu klären, aber wenn ich das Werk ausführe, ziehe ich es vor, schnell zu sein. Weil es dann diese Energie in sich trägt.
KS: Lass uns über deine Art zu malen sprechen, bevor wir uns dem aktuellen Projekt zuwenden. Ich habe das Gefühl, dass es einige grundlegende Entwicklungen gegeben hat. Im Internet findet man Bilder, die du in den 1990er-Jahren gemalt hast. Berglandschaften zum Beispiel oder ein Bild vom Stephansdom ... Sie zeugen von großer Fertigkeit im traditionellen Sinne.
AG: Vielleicht. Aber ich habe diese Arbeiten nur gemacht, weil ich etwas verkaufen musste, um zu überleben. Das war nie etwas, was mich interessiert hat. Wenn man damals solche Sachen gemalt hat, glaubte man, dass sie nie wieder auftauchen würden, weil man nicht an das Internet gedacht hat. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand sie finden würde. Und jetzt ist alles, was man in der Vergangenheit getan hat, öffentlich. Es ist online.
AG: Ehrlich gesagt ist es mir egal. Jeder Künstler hat diese Fantasie, eine saubere Biografie zu haben. Nach dem Motto: »Ich bin mit diesem Stil fast aus dem Nichts gekommen.« In Wirklichkeit haben wir alle eine Menge beschissener Malerei hinter uns.
KS: Das gilt vielleicht für die gesamte Kunst. In Charles Baudelaires Ratschlag für junge Literaten lautet der erste Satz in etwa so: »Wenn jemand von einem erfolgreichen Schriftsteller sagt: ›Das war ein beeindruckender Anfang‹, dann sieht er nicht, dass jedem Anfang immer zwanzig andere Anfänge vorausgegangen sind, von denen man nichts weiß, und dass sie die Folge davon sind.« Und doch sind die Menschen sehr neugierig auf diese anderen Anfänge. Sie sind Teil des Künstlermythos und in fast jeder Retrospektive präsent: »Sie haben ein paar Jahre lang experimentiert und dann haben sie sich selbst gefunden, und sie haben angefangen, eine Sache zu machen. Sie wurden immer besser darin, dann wurden sie schlechter und dann sind sie gestorben.«
AG: Ich frage mich, ob das in Zukunft so bleiben wird. Wahrscheinlich nicht diese Art von klarer Entwicklung. Ich persönlich gehöre wohl immer noch zur ersten Kategorie mit dieser Art des Suchens und dann des Findens. Wenn ich siebzig bin, werde ich wahrscheinlich idiotisch – obwohl auch das nicht so ganz klar ist, denn denkt man an den späten Picasso oder de Chirico, war es auch so, dass alle dachten, das, was sie täten, sei völlig idiotisch. In Wirklichkeit ist es das eigentlich gar nicht, besonders im Fall de Chiricos nicht.
KS: Manchmal ereignen sich diese verblüffenden Veränderungen nicht am Ende einer Biografie, sondern irgendwo dazwischen macht man etwas komplett anderes, wie René Magritte.
AG: Vielleicht gehört es dazu, so etwas zu tun, um sich als Künstler*in das Gefühl von Freiheit zu erhalten. Das braucht man manchmal. Man hat den Instinkt, von Zeit zu Zeit etwas zu tun, das die Leute ablehnen, um sich zu versichern, dass man immer noch für sich selbst entscheiden kann.
KS: Kannst du mir etwas über die Beziehung zwischen deinen Werken und denen von Schiele erzählen?
AG: Ich habe mich nicht viel mit Schiele beschäftigt, um ehrlich zu sein. Denn für mich ging es von Anfang an nicht um Schiele. Schiele war natürlich Teil meines geistigen Archivs, doch ich hatte nicht das Bedürfnis, ein Buch über Schiele zu kaufen, um ihn zu studieren. Darum ging es mir nicht. Die einfachen Ausdrucke mit geringer Auflösung, die du hier siehst, waren ausreichend. Aber dennoch hatte ich das Gefühl, dass ich zwei Dinge mit Schiele gemeinsam habe. Nicht hinsichtlich des Stils, sondern hinsichtlich der Haltung. Erstens hatte er diesen starken Fokus auf Selbstporträts als Vorwand, um den Körper zu erforschen. Im Grunde ist es so, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Figur schaffe, mich selbst male. Vielleicht bin ich auch einfach zu faul, um ein Modell zu finden. Letztendlich macht es nichts, wenn es nicht nach mir aussieht. Die Quelle bin ich. Ich komme also immer wieder zur selben Silhouette zurück und arbeite mit ihr. Ich glaube, dass ich zweitens das Interesse an Verformung, Streckung, dem Spiel mit der menschlichen Form mit ihm gemeinsam habe. Schiele stand am Anfang von etwas Neuem: Plötzlich war die Anatomie nur noch ein Bezugspunkt und nicht mehr das Wichtigste. Er verlängerte, streckte, verzerrte. Später, mit Picasso und anderen, wurde es zum Markenzeichen des 20. Jahrhunderts, damit zu spielen. Und das tun wir auch heute noch, wenn wir eine menschliche Figur malen. Man kann nicht zur klassischen Anatomie und dem Naturalismus zurückkehren. Ich finde, das wäre irgendwie uninteressant. Wir sind also wahrscheinlich für eine lange Zeit dazu verdammt, mit dieser – man nennt es oft »Dekonstruktion« – zu spielen, auch wenn das Wort irgendwie langweilig ist. Aber es ist etwas, das Schiele auf brillante Weise begonnen hat.
KS: Ich wäre sehr neugierig zu erfahren, was du – allgemeiner gesprochen – über die Verzerrung denkst. Ist sie eine Lösung für ein Problem? Und was ist das Problem?
AG: Ja. Zunächst einmal ist sie einfach... eine Lösung für ein Darstellungsproblem. Wir wollen die menschliche Figur darstellen, aber in Anbetracht von zweitausend Jahren hervorragender Ergebnisse im Sinne anatomischer Korrektheit ist es schwer, weiter in dieselbe Richtung zu gehen.
Das Gespräch zwischen Adrian Ghenie und Klaus Speidel in voller Länge finden Sie in unserer Publikation Adrian Ghenie – Schattenbilder.
Headerbild Adrian Ghenie © Jürgen Teller