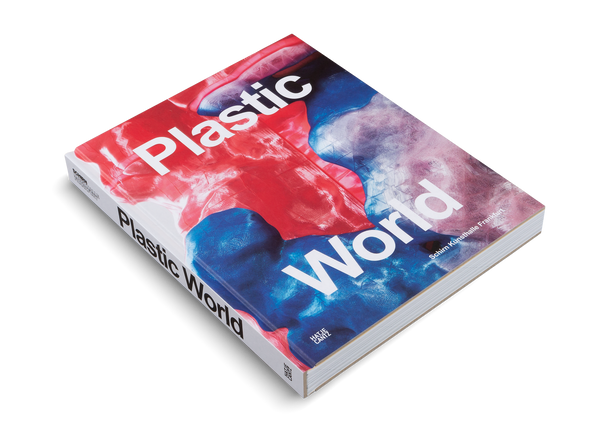| Sprache: |
GESPRÄCH ZWISCHEN MARTINA WEINHART UND FRIEDERIKE WAENTIG
»Die schönsten Schäden gibt es bei Kunststoffobjekten«
Martina Weinhart im Gespräch mit Friederike Waentig, Februar 2023
Plastic World internationalen Künstler*innen, die Plastik als künstlerisches Medium verwenden. Diese Ausstellung spannt einen Bogen von der anfänglichen Begeisterung der 1960er-Jahre für den Werkstoff über futuristische Einflüsse des Space Age bis hin zu ökokritischen Positionen.
Im nachfolgenden Interviewausschnitt spricht die Kuratorin Martina Weinhart mit der Kulturwissenschaftlerin Friederike Waentig über die Bedeutung von Kunststoffen in der bildenden Kunst. Das Gespräch vertieft die Themen der Ausstellung und beleuchtet die Herausforderungen der Erhaltung von Kunstwerken, die aus Kunststoff gefertigt sind.
(. . . )
Martina Weinhart: Ich möchte das Stichwort »Geschichte der Kunststoffe« aufgreifen. Das ist ein interessantes Feld, an dem unsere Ausstellung ansetzt. Wir beginnen ja in den späten 1950er-, frühen 1960er-Jahren und begleiten die Kunststoffe in der bildenden Kunst bis heute. In den 1950er- und 1960er- Jahren hat es eine richtige Plastik-Euphorie gegeben. Gleichzeitig entstand diese Vorstellung, der wir heute noch fälschlicherweise anhängen – Plastik, da ist alles schön, neu, glatt, bunt. Es ist das unkaputtbare Material der Zukunft. Damit haben Sie sicher jeden Tag zu tun. Aber vielleicht frage ich erst einmal ganz grundsätzlich: Wenn wir von dem Plastik sprechen, ist das eigentlich ein Missverständnis.
Sollten wir nicht besser von Kunststoffen im Plural oder zumindest von ganz
unterschiedlichen Plastiksorten sprechen?
Friederike Waentig: Tatsächlich wurde gerade nach dem Zweiten Weltkrieg im Bereich der Materialwissenschaften diskutiert, wie wir diese Werkstoffe denn benennen. Der Begriff Kunststoffe wurde von Richard Escales geprägt, der 1911 eine Zeitschrift mit diesem Titel herausbrachte, die bis heute existiert. Er hat in einem ganz, ganz langen Satz beschrieben, was zu den Kunststoffen alles dazugehört. Man hat damals sehr bewusst – es ist natürlich im Rahmen der Zeit zu sehen, 1911 – den Begriff Kunststoffe gewählt, denn es waren vorwiegend Ingenieure, die sich selbst auch als Künstler sahen, da sie neue Stoffe schufen.
Deswegen der Begriff Kunststoffe. Diesen hat man nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgegriffen, doch hat man damals auch geschaut, wie sieht es international aus, im Englischen und Französischen. In Amerika spricht man von plastic oder plastics, dort hat man sich für den Plural entschieden, und in Frankreich verwendet man das Wort plastique. Diese Begriffe gehen letztendlich auf das griechische Wort πλάσσειν (plássein) zurück, das »formen« bedeutet. In ihnen schwingt die plastische Verarbeitung dieser Stoffe mit, was im Deutschen nicht ganz geklappt hat. Durch die damalige Trennung in zwei deutsche Staaten war die Situation hier etwas speziell. Der Osten Deutschlands war bei der Begriffsbildung schneller und entschied sich für die Bezeichnung Plaste. Diese wurde auch im Westen diskutiert, war aber schon vom Osten besetzt, von dem man sich unterscheiden wollte. Deswegen hat man sich im Westen entschieden, wir sprechen von Kunststoffen. So ist es noch heute. Die Bezeichnung sollte zwar in einer DIN normiert werden, doch ist es nicht dazu gekommen. Heute sprechen manche noch von Plaste, verbreitet ist aber eigentlich Kunststoffe. Es geht ja, wie Sie auch gesagt haben, nicht nur um einen Stoff. Bei Holz wissen wir, da sind immer Zellulose, Hemizellulose und akzessorische Bestandteile beteiligt. Bei Kunststoffen haben wir Polyethylen, das ist etwas anderes als Polyethylenterephthalat, Polytetrafluorethylen oder Polymethylmethacrylat – die Zusammensetzung ist immer anders, mit anderen Eigenschaften.
MW: Ich würde das gerne gleich noch einmal ansprechen, wenn wir zu den unglaublichen Möglichkeiten kommen, die sich für die Künstler:innen eröffnet haben. Einige Künstler:innen verwenden in ihren Assemblagen unmittelbar Objekte des täglichen Lebens. Wir haben für unsere Ausstellung viele Leihanfragen für Kunstwerke aus den unterschiedlichsten Phasen der Moderne gestellt. Mit der Pop Art fangen wir an. Da hat man sofort ganz bunte Bilder im Kopf und sieht die leuchtenden Farben und glänzenden Oberflächen. Andy Warhol, Tom Wesselmann, Kiki Kogelnik (S. 37–41) und viele andere mehr. Parallel dazu ist interessanterweise der Nouveau Réalisme entstanden, der Plastik als Trash gesehen und auch so präsentiert hat. Wir haben die schmerzvolle Erfahrung gemacht, dass wir zwar
wunderbar viele Arbeiten der Pop Art für die Ausstellung ausleihen konnten, aber da
die Nouveaux Réalistes sehr stark mit Alltagsgegenständen gearbeitet haben und die Plastikproduktion in diesem Bereich nicht auf Haltbarkeit ausgerichtet war, das hier nicht möglich ist. Ich nenne nur ein Beispiel: Martial Raysse hat 1961 einen kleinen Supermarkt als Bauchladen gemacht, mit lauter Plastikutensilien, und das ist heute kaum mehr ausleihbar.
FW: Dazu ist zu sagen, dass die Kunststoffproduktion in den 1950er- bis 1970er-Jahren enorme Fortschritte gemacht hat und in dieser Zeit immer wieder neue Dinge erprobt worden sind, weshalb man heute Kunststoffe auch so entwickeln kann, dass sie dauerhafter sind. Doch in dieser frühen Phase, vor allem in den 1950er-, 1960er-Jahren, hat man das Thema Alterung noch nicht so durchdacht – bei manchen Kunststoffen bis heute nicht, das merken wir auch bei unseren Analysen, wenn wir mit Kunststoffingenieur:in nen Rücksprache halten. Bei den frühen Kunststoffen war man noch nicht so weit in der Entwicklung sogenannter Inhibitoren, also Zusätzen, die die Lichtalterung und Oxidation verlangsamen oder die Feuchtigkeitsaufnahme etwas verringern. Das heißt – bleiben wir bei den Alltagsgegenständen –, wenn ich 1959 beispielsweise einen Kaffeebecher kaufte und dann wieder 1964, konnte die Materialzusammensetzung sich unterscheiden. Vielleicht wurden beide Gegenstände aus, sagen wir mal, einem Polyester hergestellt und die Additive unterscheiden sich. Das ist eigentlich das Grundproblem für uns, die im Bereich des Kulturerbes arbeiten. Wir müssen immer schauen: Aus welcher Zeit kommt ein Objekt? Wenn ich ein Objekt aus den 1950er- oder 1960er-Jahren untersuche, muss ich davon ausgehen, dass ich Probleme mit den Farbstoffen vorfinde, dass die nicht lichtecht sind, dass die Oberfläche mit Sauerstoff reagiert und zum Beispiel auch zerkrümeln oder reißen kann. Das heißt, wenn ich ein Objekt aus dem Jahr 2020 habe, bei dem der Künstler oder die Künstlerin mit Polyethylen arbeitete, und ein Objekt aus dem Nouveau Réalisme aus den 1960er-Jahren, das ebenfalls aus Polyethylen ist, muss ich mit den beiden Materialien, den beiden Objekten unterschiedlich umgehen.
. . .
MW: Wir haben in der Ausstellung ein Kapitel, das sich den unterschiedlichen
Materialgruppen widmet. Da gibt es einerseits Polyurethanschaum-Experimente wie die Expansions von César (S. 171, 172) und Werke von Lynda Benglis (S. 174/175). Dann haben wir eine Styroporarbeit von Claes Oldenburg (S. 59), wir haben Schaumstoffarbeiten von Ferdinand Spindel (S. 166–169), wir haben Arbeiten von Joachim Bandau, die er zum Beispiel aus PVC-Abflussrohren und Teilen von Schaufensterpuppen zusammengebaut hat (S. 184, 185). Zu Bandau habe ich ein Interview gefunden, das ich ganz spannend finde, weil er sich dazu äußert, dass er ganz naiv und unbedarft mit diesen Stoffen umgegangen ist und dann schwerste Gesundheitsschäden davongetragen hat. Das war, glaube ich, im Umgang mit den frühen Kunststoffen relativ verbreitet. Damals war nicht sofort klar, was das alles mit den Menschen macht, die damit arbeiten.
FW: Das Thema Arbeitsschutz ist in der Kunstproduktion erst in den 1980er-Jahren
aufgekommen. Das sieht man an den Kunstakademien wie München und Dresden, in deren Kunststoffwerkstätten hat sich der Arbeitsschutz für Künstler:innen damals erst entwickelt beziehungsweise wurde dafür ein Bewusstsein geschaffen. In Industrie und Handwerk war der Arbeitsschutz schon sehr verbreitet. Es gab viele Künstler:innen, die zum Beispiel mit Gießharzen, also vor allem ungesättigtem Polyester gearbeitet haben. Hier ist Styrol ein Bestandteil, und dieses greift die Atemwege an. Darauf haben viele Künstler:innen nicht geachtet, weil sie es nicht gewusst haben. Sie waren fasziniert von dieser unendlichen Formbarkeit, sie konnten ihre Formen selbst bauen und die gewünschte Gestalt gießen. Das war übrigens mit dem von Ihnen angesprochenen Polyurethan Weichschaumkunststoff in anderer Weise möglich, den konnten die Künstler:innen sozusagen expandieren lassen. César hat ja auch geschrieben, dass er sich bei diesem Material nur als Dirigent fühlt – eine sehr schöne Beschreibung. Er berührte das Material gar nicht, sondern dirigierte seine Entwicklung oder den Fluss. Es ist interessant, zu untersuchen, wie Künstler:innen und Designer:innen mit den Eigenschaften des Materials arbeiten. In diesem Bereich bilden sich Künstler:innen oft eigenständig fort, auch wenn sie die Möglichkeit haben, dies an ihrer Kunstakademie zu tun. Designer:innen machen das oft in Zusammenarbeit mit der Industrie. Die BASF zum Beispiel betreibt das Creation Center (früher Design Fabrik), wo Designer:innen über das Material und die Technik beraten werden, eine solche Institution
gibt es für bildende Künstler:innen nicht. Deswegen ist es auch für uns im Umgang mit dem Kulturerbe wichtig, immer genau hinzuschauen. Ist mit dem Material richtig umgegangen worden? Der italienische Designer Gaetano Pesce zum Beispiel hat unter anderem mit Polyurethan-Gießharzen gearbeitet und Stühle hergestellt, die irgendwann gummihaft geworden sind. Man wusste nicht warum. Das haben wir durch eine Forschungsarbeit herausgefunden, die zum Designer recherchiert und
mit ihm – damals lebte er noch – gesprochen hat: Er hatte verschiedene Chargen
zusammengeschüttet. Daraufhin konnten die Chemiker:innen die Stühle nochmal
untersuchen und feststellen, dass sich eine Molekülstruktur verändert hatte, weshalb aus diesem harten Gießharz ein weiches Gummi geworden war. Immer wenn Künstler:innen in ihrem Atelier, plump gesagt, »frei nach Schnauze arbeiten«, kann das für die dauerhafte Erhaltung der Objekte schwierig werden.
MW: Was sich seit den 1950er- und 1960er-Jahren, seit der etwas naiven Begeisterung gegenüber den Kunststoffen, geändert hat, ist die Haltung, die wir heute Plastik gegenüber einnehmen. Natürlich sehen wir immer noch die unendlichen Möglichkeiten, aber wir sehen auch die Gesundheitsfolgen und darüber hinaus die Schäden an der Umwelt. Die Industrie hat in dieser Richtung scheinbar nachgebessert. Stichwort Green Plastics, die vor allem für den Alltagsgebrauch entwickelt wurden, sie begegnen uns aber auch zunehmend in der
bildenden Kunst.
FW: Green Plastics ist ein schwieriger Begriff, weil er eigentlich behauptet, dass Kunststoffe grüne Werkstoffe, also biologisch abbaubar sind, ähnlich den Naturmaterialien. Doch werden Green Plastics durch keine Norm definiert. Es gibt sogenannte Bio-Kunststoffe oder auch biologisch abbaubare Kunststoffe, die unter Green Plastics firmieren, weil sie praktisch rückstandsfrei wieder abgebaut werden können oder in den biologischen Kreislauf zurückkehren, nach dem Prinzip des »cradle to cradle«. Also Werkstoffe sind, die den Naturstoffen ähneln. Ich finde das immer etwas verwirrend, denn dabei wird vergessen, dass wir in der Natur auch viele Giftstoffe haben. Wir müssen versuchen, das Ganze neutral zu betrachten: Ich stelle einen Werkstoff her, dazu brauche ich Materialien, dazu brauche ich Energie, ich brauche Maschinen, und zudem muss ich möglichst nachhaltig arbeiten – auch
das ist mit »green« ja gemeint. Das heißt, dass ich wenig Schadstoffe in die Atmosphäre gebe, auch beim Verarbeiten der Materialien. Das versucht man mit dem Begriff Green Materials zusammenzufassen. Wenn wir den Blick jetzt wieder auf die Kunststoffe richten und von Green Plastics oder biologisch abbaubaren oder recycelbaren Kunststoffen sprechen, ist es aber so, dass wir bei der Herstellung und Verarbeitung ein Problem haben. Für die biologisch abbaubaren Kunststoffe müssen die Verarbeitungstechniken weiterentwickelt werden, um eine gleichmäßige Qualität zu produzieren, und aus 100 Prozent Recyclat kann man keinen neuen Kunststoff herstellen. Ich kann immer nur einen gewissen Prozentsatz Recyclat verwenden, zu dem ein gewisser Prozentsatz neuer Kunststoffe hinzukommen muss.
. . .
MW: Ich denke, es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, ob wir jetzt von Plastik in der Umwelt, in der Gesellschaft, in unserem täglichen Leben sprechen oder von Plastik in der bildenden Kunst. Das sind sicher zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ich würde gerne nochmal zum Alterungsprozess und darüber ins Museum, sozusagen in die Ausstellung zurückkommen. Also die Alterung ist Fakt, das haben wir spätestens jetzt gelernt. Wie aber gehen wir mit der Alterung um? Im Prinzip gibt es nur zwei Wege. Wenn ein Kunstwerk in den 1960er-Jahren entstanden und heute nicht mehr ausstellbar ist, muss ich entweder sagen: Ich akzeptiere diese Vergänglichkeit und verstehe es als ein ephemeres Kunstwerk. Viele Künstler:innen legen es ja auch schon so an und sagen: Ok, das Kunstwerk hat seine Zeit, es gehört in eine bestimmte Zeit und die ist jetzt vorbei. Oder ich ziehe eine Rekonstruktion in Betracht, das ist die andere Möglichkeit.
FW: Das ist ein sehr spannendes Thema. Also entweder sage ich: Ich begleite die
Vergänglichkeit und versuche das Kunstwerk so gut es geht zu dokumentieren. Oder ich untersuche das Kunstwerk, schaue mir die Materialien genau an und prüfe, wo ich etwas ergänzen oder ersetzen kann, um dem Kunstwerk die Ausstellbarkeit oder Lesbarkeit zu erhalten. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich habe mich lange intensiv mit einem Kunstwerk beschäftigt, das aus Kunststoff, Metall und Holz war, ein einziges Teil aus Celluloseacetat. Das Celluloseacetat ist beim Sammler irgendwann von der Wand gefallen, weil es durch die Alterung zerfiel. Was mache ich jetzt damit? Eigentlich fehlt ja nur eine Scheibe. Es gibt Kolleg:innen, die in einem solchen Fall irgendeinen Kunststoff nehmen, der transparent ist und den man bearbeiten kann, und montieren das neue Teil wieder. Oder aber ich beschäftige mich mit dem Künstler oder der Künstlerin, ihrer oder seiner Intention und damit, wie er oder sie mit den Materialien umgegangen ist, und versuche, das fehlende Teil in diesem Sinne zu rekonstruieren. Das heißt, ich versuche es mit genau dem Material, mit dem ursprünglich gearbeitet wurde. Auch wenn die Zusammensetzung heute nicht mehr die gleiche ist wie früher, kann ich mich daran annähern; die Industrie bietet heute Datenbanken für die verschiedenen Kunststoffe an. Wenn ich von dem historischen Objekt noch eine Probe habe, kann ich es untersuchen, um die physikalischen und chemischen Eigenschaften zu bestimmen, und mit den Ergebnissen kann ich mir einen sehr ähnlichen
Werkstoff heraussuchen. Anhand der Werkspuren kann man die Arbeitsweise der Künstlerin oder des Künstlers rekonstruieren. Vor den Versuchen stellt sich die Frage, ob so etwas technisch möglich ist. Und wenn es technisch möglich ist, stellen sich weitere Fragen: Was bedeutet das für das Kunstwerk? Muss ich der Datierung Schrägstrich 2023 hinzufügen?
Und habe ich nur ein Stück ergänzt oder mehr als 50 Prozent? Wie gehe ich damit um? Was bedeutet diese Vorgehensweise für das Objekt? Was habe ich dann am Ende? Wenn ich 50 Prozent der Kunststoffe ergänzt habe, ist es dann ein Objekt des 21. Jahrhunderts? Oder habe ich noch das Objekt des 20. Jahrhunderts? Und wer ist eigentlich der Urheber? In den Museen fehlt es noch an Diskussion zu den Kunststoffen, um hier weiterzukommen. Denn gerade im Bereich der modernen und zeitgenössischen Kunst wird recht häufig ergänzt – es wird aber zu wenig mit den Kurator:innen diskutiert, so wie wir beide es jetzt hier machen. Ich denke, dass wir durch die fortschreitende Technologie, die uns 3D-Scanner und 3D-Drucker bieten, das Thema Rekonstruktion oder Ergänzung viel besser diskutieren können, auch die Frage, ob so etwas technisch möglich ist. In der Diskussion müssen wir aber auch darüber sprechen: Was habe ich am Ende? Und ich muss ehrlich fragen: Wie
verändere ich das Kunstwerk? Darüber hinaus muss uns klar sein: Jeder Eingriff, den wir als Restaurator:innen an einem Werk vornehmen, ist ein Eingriff in das Urheberrecht, ist eine Veränderung, die deutlich gemacht werden muss.
MW: In den nächsten Jahren werden uns noch viele solche Aufgaben
beschäftigen.
Das komplette Interview finden sie in unserem Buch Plastic World.
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.